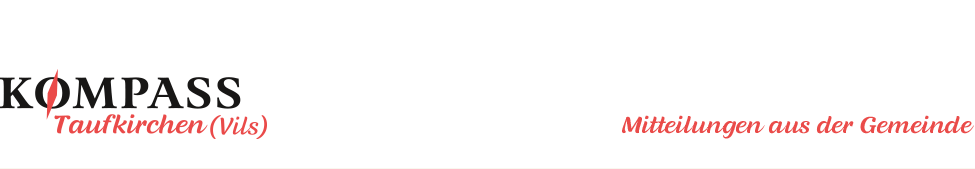Joseph Bartl (Name geändert) wurde 1923 als viertes von acht Kindern im Erdinger Holzland geboren. Der Vater starb früh und so musste er bereits als Kind schwere Arbeit auf dem heimatlichen Hof leisten. 1942 wurden er und seine beiden älteren Brüder als Soldaten an die russische Front geschickt. Nur Joseph Bartl überlebte.
1946 kehrte er aus russischer Gefangenschaft zurück, übernahm das elterliche Anwesen und hat darauf mehr als fünfzig Jahre hart gearbeitet. Vor fünf Jahren starb seine Frau, mit der er drei Kinder großgezogen hat. Urlaub kannte der Landwirt nicht, am liebsten war er zuhause auf seinem Hof.
Dass das Bier im letzten halben Jahr nicht mehr so gut schmeckte wie früher, führte er auf seinen empfindlichen Magen zurück. Vor einigen Wochen wurde der Rentner mit unklaren Bauchschmerzen in eine Münchner Klinik eingewiesen. Dort stellten die Ärzte fest, dass sie dem alten Mann nicht mehr helfen konnten. Ein bösartiger Tumor hatte nicht nur seinen Bauchraum, sondern bereits den ganzen Körper erfasst.
Die Tochter berichtet:
„Nach dieser Diagnose wollten wir unseren Vater unbedingt mit nach Hause nehmen, aber die Ärzte rieten davon ab, denn er hatte immer wieder starke Schmerzen. Er wurde zunehmend schwächer und verweigerte jede Nahrung. Eine Ernährungssonde lehnte er vehement ab. Vater fühlte sich verloren in dieser großen Klinik. Er wollte unbedingt heim, doch wir hatten große Bedenken.
Eine Bekannte riet uns aus eigener Erfahrung, mit dem Erdinger Christophorus Hospizverein Kontakt aufzunehmen. Obwohl uns schon das Wort „Hospiz“ etwas ängstigte, haben wir schließlich doch angerufen. Das war eine glückliche Wende in dieser für uns völlig hilflosen Situation. Bereits nach dem ersten Besuch der Palliativschwester wurde uns die Angst davor genommen, Vater nach Hause zu holen.
Aus diesem Erstgespräch heraus entstand ein Verständnis dafür, dass es sich beim Sterben um einen natürlichen Prozess handelt, den wir in Ruhe und mit Respekt begleiten dürfen, wenn wir dies auch wollen. Eine Palliativstation wäre die mögliche Alternative, falls das Krankheitsgeschehen zuhause aus dem Ruder laufen sollte. Medizinisch und palliativ-pflegerisch stünde uns der Verein mit seiner 24 Stunden rund um die Uhr-Rufbereitschaft zur Seite, in enger Zusammenarbeit mit dem Hausarzt und dem hiesigen Pflegedienst.
Damit stand unser Entschluss fest. Bereits am nächsten Tag holten wir unseren Vater nach Hause. Vor Ort war bereits alles Nötige organisiert. Die Ärzte erstellten einen Medikamentenplan, den die Palliativschwestern zusammen mit dem Hausarzt stets den aktuellen Bedürfnissen anpassten.
Es war eine Freude und Erleichterung mit anzusehen, wie mein Vater wieder aufblühte. Trotz seiner schweren Krankheit war er im Kreise seiner Familie, fühlte sich wohl und wurde von seinen früheren Stammtischkollegen besucht. Besonders freute ihn, wenn die Enkelkinder kamen oder die Katze in sein Bett hüpfte, um sich bei ihm auszustrecken.
Einmal wöchentlich besuchte uns ein ausgebildeter Hospizhelfer, mit dem wir tröstende Gespräche führen konnten und der mit unserem Vater auch mal ein paar Stunden alleine verbrachte. Vater wirkte nach diesen Besuchen immer aufgeheitert; ich denke er konnte einem ‚Fremden’ vielleicht manches aus seinem Leben eher anvertrauen als uns Kindern.
Ende November wurden die Schmerzen wieder stärker. Nun kam die Schwester regelmäßig, um Morphin zu spritzen und spezielle Medikamente über eine Infusion zu verabreichen. Anfang Dezember verfiel Vater in eine Art Schlaf. Nur noch gelegentlich öffnete er die Augen, bis auch die Atmung immer schwächer wurde. Diese Phase war für uns sehr belastend. Ich denke, ohne professionelle Hilfe hätten wir ihn vielleicht aus Angst, etwas falsch zu machen, ins Krankenhaus einweisen lassen.
Am 4. Dezember ist unser Opa friedlich verstorben. Im Haus war danach viel Frieden und eine sehr würdevolle Stimmung zu spüren, die uns wahrscheinlich noch lange begleiten wird. Ich habe das Gefühl, dass wir den Alltag ein wenig aufrechter meistern, weil wir es unserem Vater ermöglicht haben, daheim zu sterben. Uns ist auch deutlich geworden, dass das Leben vor allem dadurch seine Besonderheit erfährt, dass es nicht ewig währt und dass wer den Tod verdrängt, damit auch die Chance auf ein bewussteres Leben verpasst.“
Wie anfangs diesen Angehörigen ergeht es vielen, denen die Arbeit der Hospizvereine nicht bekannt ist. Hier wird im Verborgenen Pionierarbeit geleistet. Woher Schwestern und Hospizhelfer die Kraft für ihre Tätigkeit nehmen, ist oft ein Rätsel. Die Arbeit der Palliativfachkräfte wird über Spenden finanziert, die Einsätze der Helfer sind ehrenamtlich – unerwartet in einer von materiellem Denken geprägten Zeit.
Die Betroffenen in unserer Geschichte hatten Glück, denn der östliche Landkreis wird von den Schwestern nur selten angefahren, weil die Wege lang und die damit verbundenen Kosten beträchtlich sind. Zukünftig soll sich dies ändern, denn der Verein plant ein landkreisweites Netzwerk, in Kooperation mit der Klinik Wartenberg und der Klinik Dorfen.
Die Kosten für den Aufbau des Netzwerkes belaufen sich auf mehrere 100.000 €, die der Verein selber aufbringen muss. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob man die Arbeit von Menschen, die in selbstloser Art Todkranken und deren Familien beistehen, nicht mehr unterstützen und fördern sollte. Wir spenden für Menschen und Projekte weltweit und vergessen manchmal das Leid der nächsten Nachbarn.
Zu guter Letzt sollte uns bewusst werden, dass wir unausweichlich irgendwann selber Betroffene sein werden. Sicher wünschen sich viele todkranke Menschen, ihre letzten Tage zuhause im Kreise der Familie verbringen zu dürfen. Leider war es bisher nur wenigen aus Mangel an den dafür notwendigen Strukturen gegönnt.