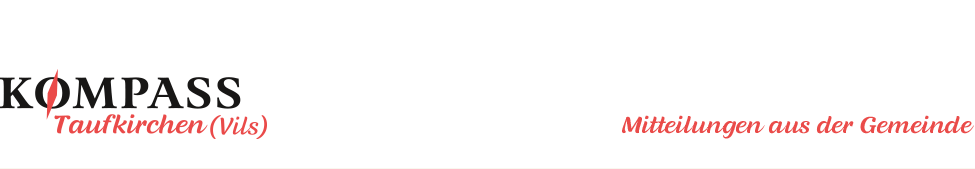Diese Wortschöpfung, die zum ersten Mal im sogenannten „Hartz-Papier“ auftauchte,
wurde 2002 zum Unwort des Jahres gewählt. Das zuständige
Gremium begründete die Wahl damit, dass Ich-AG ein Beleg für
die zunehmende Gepflogenheit sei, „schwierige soziale und
sozialpolitische Sachverhalte mit sprachlicher Kosmetik schönzureden“.
Dass
der Begriff gerade in diesen Zeiten geprägt wurde, ist
allerdings auch Beleg für eine andere „Gepflogenheit“.
Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich zu allen Zeiten von irgend
jemand beklagt wurde, „Ich“ wird ganz offensichtlich
wieder mal und immer größer geschrieben, das zeigen
nicht nur die Selbstdarstellungs-Riten exponierter Mitglieder unserer „Ellenbogen-Gesellschaft“.
Auch
in unserer allernächsten Umgebung trifft man auf dieses
Phänomen, das so unausrottbar zur menschlichen Psyche zu gehören
scheint wie der Drang vieler Menschen, sich im Sommer möglichst
vieler Kleidungsstücke zu entledigen. Wer das betretene Schweigen
kennt, das einsetzt, wenn beispielsweise bei einer Elternbeirats-Sitzung
freiwillige Helfer für das nächste Schulfest gesucht
werden, der weiß, wovon hier die Rede ist.
Der Trend setzte
allerdings nicht erst gestern ein. Es ist schon geraume Zeit Usus,
vieles als selbstverständlich zu betrachten,
vorausgesetzt, man ist nicht selber aufgefordert einen Beitrag
zu leisten. Feiern tun wir gerne, nur die Biertische hin und anschließend
den Dreck wegräumen, das ist nicht so sehr beliebt.
Der Grundgedanke,
der diese innere Einstellung immer wieder rechtfertigt, ist oft
recht simpel: Wollen würde man schon mögen, aber
gerade an diesem Tag passt es überhaupt nicht! Weshalb die
Arbeit dann immer wieder an den selben hängen bleibt, an Menschen
nämlich, für die das Wort „sozial“ kein Relikt
aus dem Kommunistischen Manifest von Marx und Engels ist, sondern
eine Möglichkeit umschreibt, mit anderen Menschen auf durchaus
angenehme Weise zusammen zu leben. Menschen, die nicht andauernd
fragen, wer denn dafür zuständig sei, sondern anhalten
und die gefährlich große Kiste, die ein Lastwagen verloren
hat, von der Straße räumen.
Aber meistens sind es halt
doch die Anderen. Die die Müll-Container
sauber halten müssten. Die sich im Verein mehr engagieren
könnten. Als ob man Angst hätte, sonst das Himmelreich
zu riskieren, schauen zu viele Menschen erst einmal auf ihren Vorteil.
Weil sie Angst haben, als Verlierer da zu stehen, wenn ein Anderer
etwas davon haben könnte. Und sie merken gar nicht, dass sie
die Verlierer sind.
Sie merken nicht, dass sie so auf vieles verzichten
müssen,
was das Leben eigentlich recht angenehm und erfreulich machen kann.
Denn es gibt keine Ich-AG, die langfristig Gewinn abwirft. So paradox
das ist: obwohl sich viele Menschen nicht als soziales Wesen zeigen, „Gesellschaft“ brauchen
sie fast alle. Warum sonst würden so viele an der Einsamkeit
verzweifeln.
Miteinander wird das Leben lebenswerter, auch wenn
es dieses Miteinander nicht umsonst gibt. Da sind Taten gefragt
und nicht nur Worte.
pebe