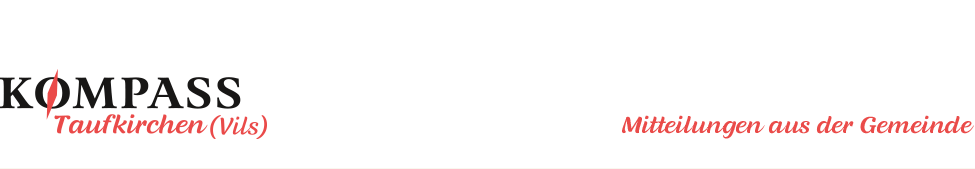Ein Bericht von Ayse Beyer
 In den bisherigen Kompassartikeln zum Thema Inklusion ging es um echte Barrieren wie Wege, Hindernisse und die daraus resultierenden konkreten Probleme. Ich berichte in meinem Beitrag über ein Thema, das jeder subjektiv wahrnimmt, denn es geht nicht um eine direkt messbare Einschränkung.
In den bisherigen Kompassartikeln zum Thema Inklusion ging es um echte Barrieren wie Wege, Hindernisse und die daraus resultierenden konkreten Probleme. Ich berichte in meinem Beitrag über ein Thema, das jeder subjektiv wahrnimmt, denn es geht nicht um eine direkt messbare Einschränkung.
Die Frage, ob ich mich in Taufkirchen (Vils) integriert fühle, kann ich nur unter Berücksichtigung meiner Erfahrungen aus der Vergangenheit beantworten. Glücklicherweise waren sie in der Regel positiv. Vielleicht liegt es daran, dass ich durch meine Persönlichkeit einem Spruch wie „Ach, schau an, da kommt die Schwarze!“ keine große Bedeutung beimesse und einfach mit einem frechen Spruch antworte. Vielleicht ist es sogar mein Geschlecht, das es mir etwas erleichtert. Ich habe oft beobachtet, dass es Männer schwieriger haben, in einer Gesellschaft, einem Freundeskreis oder dem Arbeitsumfeld integriert zu sein oder sich entsprechend zu fühlen. Frauen wird oft eine Opferrolle zugeordnet, die eher ein Helfersyndrom weckt. Im Gegensatz dazu bestehen gegenüber ausländischen Männern meist negative Vorurteile.
Den Wohlfühlfaktor, den ich erreicht habe, hatte ich nicht mein ganzes Leben. Aufgewachsen in der zweiten Generation in Deutschland in einem sehr konservativen Elternhaus sind sehr oft zwei Welten aufeinander geprallt, in denen ich mich zurecht finden musste. Das strenge Elternhaus stand im Kontrast zu den liberalen Erziehungsmethoden bei Freunden. Es gab andere Ess- und Trinkgewohnheiten und auch äußerlich war ich immer anders. Besonders schwierig ist es, wenn sich auch die Religion zusätzlich zur Kultur und Sprache der anderen unterscheidet. Ich frage mich, wie tolerant Menschen mir gegenüber wären, wenn ich ein Kopftuch, einen Sari oder einen Turban tragen würde. Toleranz fängt für mich erst da an, wenn man etwas, das man nicht kennt und vielleicht auch nicht ohne weiteres verstehen kann, trotzdem nicht verurteilt.
Ich kann sagen, dass ich mich in Deutschland integriert fühle. Eigentlich stelle ich mir die Frage der Integration gar nicht, weil ich mich hier nicht fremd fühle und auch nicht als Fremde wahrgenommen werde. An meinen Eltern kann ich jedoch sehen, wie schwierig es ist fremd zu sein. Sie konnten nicht richtig Deutsch und hatten auch keine deutschen Freunde. Am öffentlichen Leben haben sie nicht teilgenommen. Trotzdem ist es ihnen gelungen, ihren Kindern einen Weg in die Mittelschicht zu ermöglichen.
Daher sieht mein Leben heute anders aus. Als ich nach Taufkirchen (Vils) gezogen bin, habe ich selbst über meine Kinder Anschluss in der Nachbarschaft gefunden. Besonders wichtig finde ich es, dass sich die Menschen innerhalb von Vereinen, ehrenamtlicher Arbeit oder bei Veranstaltungen begegnen und einander besser kennen lernen. Nur so kann man Vorurteile verhindern.